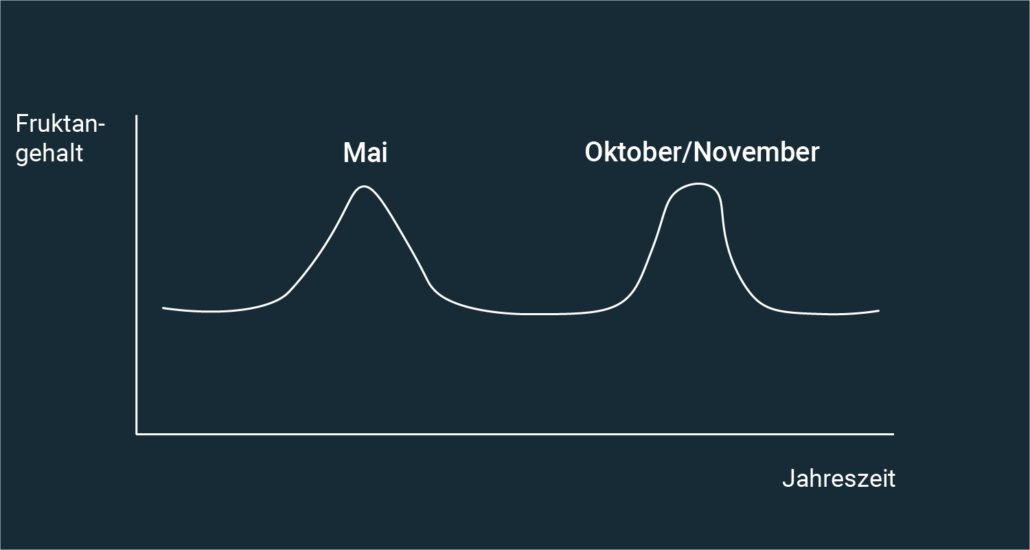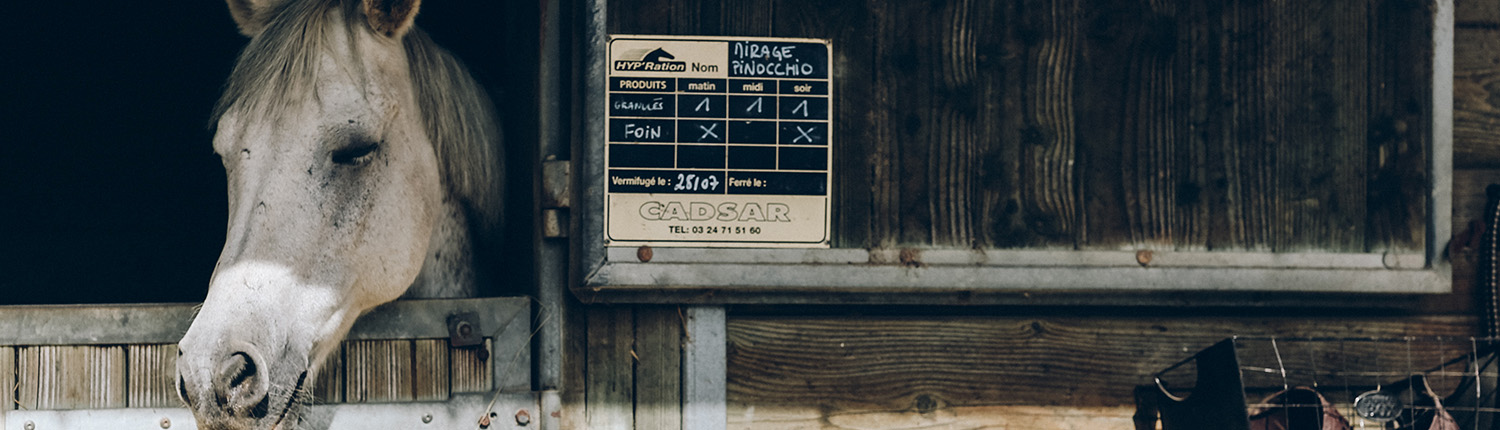HorseAnalytics Blog
Wieviel Heu sollte ein Pferd bekommen?
Stets verfügbares Heu ist nicht für jedes Pferd optimal Die Vorfahren unserer Hauspferde haben in der Steppe gelebt und oft 16 bis 18 Stunden pro Tag der Nahrungssuche und –aufnahme gewidmet. Dabei haben sie stets kleine Mengen an Nahrung aufgenommen und unzählige Kilometer zurückgelegt. Und genau darauf ist der Verdauungstrakt der Pferde ausgerichtet: Kleine Mengen, […]
Gutes Heu und dessen Vorteile
WIE VIELE NÄHRSTOFFE, MINERALIEN, SPURENELEMENTE UND ENERGIE ENTHÄLT HEU WIRKLICH? Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Wasser, Mineralien, Spurenelemente und Vitamine sind die lebenswichtigen Nährstoffe, die das Pferd braucht. Wirklich hochwertiges Heu enthält ausreichend viele davon, so dass ein Pferd bei Erhaltungsbedarf und auch noch bei leichter Arbeit problemlos alleine von qualitativ gutem Heu in ausreichender Menge […]